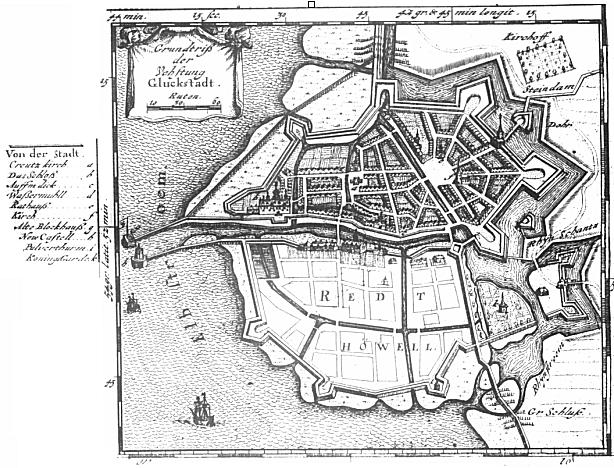Man betritt den Ausstellungsraum im Museum für Kunst & Gewerbe und steht inmitten eines Theatersaals. Sieben Bühnenpodeste werden hier gleichzeitig bespielt. Besucherinnen bewegen sich zwischen angeleuchteten Installationen, Spiegelwänden und großen Schwerlastregalen, in denen Kleider und Accessoires Platz finden – Mobiliar eigentlich aus Archiven und Lagerhallen.
Meterhohe, dunkle Vorhänge trennen die Szenen voneinander ab. Die Beleuchtung ist gedämpft, denn die filigranen Archivobjekte sind lichtempfindlich. Manchen haben die Jahrhunderte zugesetzt, manchen die Kriege, einigen die Frauen selbst. Die Kleidungsstücke waren einmal Gebrauchsgegenstände. Sie zeigen die Spuren der Lebenszeit, die die Frauen in Tageskleidern, Abendroben, und Mänteln verbracht haben und die Erinnerungen, die in Hochzeits-, Tauf- und Trauerkleidern aufbewahrt sind.
Sieben Konvolute aus dem Bestand des Museums zeigt die Ausstellung »Dressed. 7 Frauen – 200 Jahre Mode« und zeichnet anhand der Objekte sieben Frauenbiografien aus 200 Jahren nach. Archiv, Biografie und Zeitgeschichte kreuzen sich in diesem Konzept in stofflicher, sinnlich erfahrbarer Weise. Angereichert mit Hintergrundwissen, das über Tablets dargestellt wird.
Die Kleidungsstücke selbst zeugen von Technik- und Handelsgeschichte. Sie markieren nicht nur Stationen innerhalb der Modegeschichte, sondern haben auch selbst eine Archivfunktion, die die Kuratorin Angelica Riley mit ihrer Arbeit unterstreicht.

Die Verlegergattin Elise Fränkel trug im biedermeierlichen Oldenburg in Holstein modische, elegante Ballerinas aus Paris, ihre aufwändig gearbeiteten Tüllkragen und feinste Spitze sind mit Etiketten in kyrillischer Sprache versehen. In der holsteinischen Provinz kursierten aktuelle Modezeitschriften und Händler aus Kopenhagen, Lübeck, Paris und Osteuropa präsentierten offenkundig ihre Waren der geschmackssicheren und potenten Käuferin. Die Objektbeschreibungen in der Ausstellung haben das Layout von wissenschaftlichen Karteikarten. Auf ihnen sind Maße, Entwurf, Marke, Herstellung, Technik und eben auch akribisch der Zustand des Gegenstandes vermerkt: Schweißflecken, unter den Achseln desolat, geflickt, geweitet, gestopft, geändert, Knöpfe versetzt. In langen Ballnächten wurde geschwitzt, in Kriegszeiten haben Frauen die Kleidung sorgsam ausgebessert, nach Geburten und in mittleren Jahren haben sich die Figuren verändert.
Von Elise Fränkel selbst gibt es keine historischen Zeugnisse, wohl von ihrem Mann. Ihre Biografie kann über ihren Mann erzählt werden oder aber durch ihre Garderobe. Die Nadel erzählt Frauengeschichte.
Von Erika Holst besitzt das Museum ein Konvolut von Alltagskleidung aus der NS-Zeit und dem 2. Weltkrieg. Was den Zustand und die Materialien angeht, ein Zeitspeicher von eindrücklicher Kraft. Die Erinnerung vieler Besucherinnen wird in diese Zeit zurückreichen, in der ihre Großmütter und Mütter lebten und von denen es noch Fotos in den Familienalben gibt. Doch wer kann noch ein Kleid seiner Großmutter berühren? In eines von Erika Holst ist das Etikett des Hamburger jüdischen Modegeschäfts Gebrüder Robinson eingenäht, das 1938 verwüstet wurde. Weiterlesen